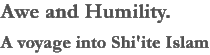
Hans Georg Berger
Die Stille der Lernenden
Über meine fotografische Arbeit in den theologischen Schulen und Universitäten von Qom, Maschhad und Isfahan
Sehr langsam, und nur für einen kleinen Spalt öffnet sich die schmale Pforte im silberbeschlagenen Tor der ehrwürdigen Koran-Universität von Chahar-Baq im Zentrum von Isfahan, um mich zum ersten Mal einzulassen. Es hat langer Gespräche und einiger Empfehlungen bedurft, damit ich für einen kurzen Besuch empfangen werde. Als sich die Pforte hinter mir schließt, ist die plötzliche Stille verblüffend. Ich stehe in einem über zwei Stockwerke reichenden Eingangs-Iwan, der sich zum quadratischen, weiten Innenhof der Hauza öffnet, den ein lang gestrecktes, tiefes Wasserbecken in zwei gleiche Teile aufteilt; blühende Sträucher, sorgsam geschnittener Rasen, dunkle Zypressen verbreiten zusammen mit dem Wasser des Beckens Kühle und Ruhe. Drei weitere Iwane (jene für die persische Architektur typischen, hohen Loggien, die sich zu innen liegenden Gärten öffnen) unterbrechen die zum Gartenhof orientierte zweistöckige Reihe von Kammern, in denen die Lehrer und Studenten der Hauza leben; über dem südlichen Iwan erhebt sich, blau und weiß gefliest, die mächtige Kuppel der Moschee, die das Zentrum der Hauza bildet. Die Anlage aus dem 16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ist von solchem Ebenmaß, von solch unirdischer Schönheit, dass es mir den Atem verschlägt: nie zuvor habe ich einen Ort des Lernens gesehen, dessen Architektur schon auf den ersten Blick so vollkommen scheint, so konzentriert, so makellos.
Im Garten, in den Iwanen, in den sich anschließenden Studiensälen sitzen die Studenten beisammen, zu zweit diskutierend oder in kleinen Gruppen um einen Lehrer geschart, über die den Garten aufteilenden Wege eilen sie, mit der vom Wind aufgeblähten abaya, dem leichten Mantel der schiitischen Geistlichen zum Unterricht. Neben der Herrlichkeit und Wucht der Architektur ist die Stille das Erstaunlichste hier; es ist still im Verhältnis zum Lärm der Strasse der Vier Gärten (dies bedeutet Chahar-Baq), die eine der geschäftigsten Strassen der Safawiden-Hauptstadt Isfahan ist; still auch im Verhältnis zum Raunen der Studenten in den Madresen der Sunniten, die ich in Pakistan oder in Nordafrika besucht habe. Ich betrete den stillen Ort in Isfahan ohne nähere Kenntnis dessen, was in ihm geschieht, ohne Bekanntschaft mit denen, die dort leben und arbeiten, mit nur rudimentärer Kenntnis des Islam, der Schia, der komplexen geistigen, sozialen und politischen Umstände, die in diesem Ort herrschen. Es ist Sommer 1996 – meine erste Reise nach Persien. Ich bin unwissend konfrontiert mit äußerst Fremdem. An diesem und ähnlichen Orten Persiens möchte ich arbeiten, meinen Plan fortsetzen, die Weltreligionen und ihre Lehrsysteme zu erkunden. Was für mich spricht in dieser Lage ist, nahezu ausschließlich, mein Wissen um meine Unwissenheit – und die Bereitschaft, diese Unwissenheit freimütig und von Anfang an zuzugeben, sie gar zur Bedingung meines Aufenthalts zu machen: Ich weiß nichts von Euch – Ihr müsst mir alles, wenn ich Euch verstehen soll, wie einem Kind erklären.
Diese Haltung ist seit langem ein wesentliches Prinzip meiner fotografischen und künstlerischen Arbeit. Ich begebe mich in Situationen, in denen ich „der Fremde“ bin: wo ich mich zurechtfinden muss in einer Kultur, die nicht meine ist, wo ich mit einer Sprache konfrontiert bin, die ich erst im Lauf der Arbeit erlerne, wo ich neben der künstlerischen Arbeit eine Vielzahl von sozialen, anthropologischen, ethnologischen Informationen aufnehme und in die Arbeit einbringe. Giorgio Conti hat mich in einem seiner kritischen Texte einen „umgekehrten Migranten“ genannt, der sich radikal und schutzlos auf ein ihm fremdes, neues Leben einzustellen hat. Aus meinem Nicht-Wissen, aus meinem Lernen-Wollen entsteht eine Dynamik der Beziehungen zu denen, die wissen. Sind sie bereit, mit mir zu sprechen, mich bei sich aufzunehmen, mir zu vertrauen? Das ist immer die erste Frage; die zweite Frage ist dann schnell: bin ich auf der Höhe ihres Diskurses? Wie weit können sie mit mir gehen? Wo endet meine Unbefangenheit, wo sind die Grenzen meines Verstehens?
Es geht um die Organisation einer Begegnung – und darin um Kontinuität, um Verlässlichkeit, um die Herstellung von Vertrauen. Ich zeichne auf: ich fotografiere, ich schreibe nieder, was mir erklärt wird, ich mache Tondokumentationen, ich mache kleine Videofilme. Das sind Übersetzungen dessen, was ich erfahre, in verschiedene, im Westen seit langem erprobte Medien. Damit diese Übersetzungen nicht reine Dokumentation bleiben, verwende ich einen künstlerischen Ansatz, den Joseph Beuys als „Soziale Skulptur“ definiert hat: der Begriff meint die Entwicklung eines gemeinschaftlichen Projekts, das alle Beteiligten gleichberechtigt einbindet und in die Lage versetzt, selbst künstlerisch zu wirken. Dabei entstehen Kunst-Dokumente, die sowohl innerhalb des Arbeitszusammenhangs als auch „außen“ rezipiert werden können – auf jeweils andere Art und Weise, mit jeweils anderen Bedeutungen und Konsequenzen. Es entsteht eine ungewöhnliche, möglicherweise neue Form von Authentizität. Das, was ich später als künstlerische Spur eines Arbeits- und Kommunikationsprozesses zeigen werde, wurde nicht nur in einem langen Arbeitsprozess geprüft und schließlich bestätigt; seine Entstehung war schon Definitionen, Methoden und Notwendigkeiten unterworfen, die die an der Arbeit Beteiligten eingebracht haben. Im Falle der Fotografien aus den schiitischen theologischen Schulen und Universitäten bedeutet dies: die jungen Geistlichen und ihre Lehrer waren die Protagonisten und Gestalter dieses Prozesses – ich war sein Moderator.
Mein Besuch in der Hauza von Chahar-Baq in Isfahan war der erste Schritt in einem Arbeitsprozess, der sich unregelmäßig über mehrere Jahre erstreckte. Er begann damit, Wege zu finden, eine Reihe von Bedenken zu überwinden, die meiner Absicht entgegenstanden, und die niemanden besonders erstaunen dürften: die theologischen Schulen in Iran sind Orte der Abgeschiedenheit und der Konzentration, zu denen Außenstehende keinen Zugang haben. Sie sind Orte der muslimischen Lehre, Nicht-Muslimen eigentlich verschlossen. Das Bild-Verbot des Islam, wenngleich gerade im Schiismus anders, und weniger radikal ausgeprägt als bei den Sunniten, ließ die Fotografie anfänglich als ein recht extravagantes Medium für ein Kunst-Projekt mit jungen islamischen Geistlichen erscheinen. Und vor allem: dass ein westlicher Künstler in der Zeit umfassender, teils gewalttätiger Konflikte zwischen den beiden Welten das Gespräch im innersten Bereich der Ausbildung islamischer Geistlicher sucht und findet – es schien manchem, als es begann, ein aussichtsloses Unterfangen. Es gab, nicht nur in der Vorbereitung, Rückschläge und Unverständnis – übrigens nicht nur auf der einen Seite. Allen Schwierigkeiten zum Trotz hat sich mein Projekt mit der Hilfe Vieler dennoch realisiert - und kam im Jahre 2004 mit der systematischen Diskussion der Arbeitsergebnisse in den Hauzas, die ich im Lauf der Jahre in Isfahan, Maschhad und Qom besucht hatte, zu einem vorläufigen Abschluss.
Die herrliche Hauza von Chahar-Baq ist nur in der baulichen Konzeption beispielhaft für die zahlreichen theologischen Schulen und Universitäten von Maschhad, Qom und Isfahan, in denen sich mein Kunst-Projekt entwickelte; es gibt, in Isfahan selbst und in anderen Städten Irans, sowohl größere als auch sehr viel kleinere, bescheidenere Schulen; es gibt theologische Universitäten, die zahlreichere Studenten unterrichten; es gibt Universitäten, deren Ruf und Reputation als Zentren der Gelehrsamkeit sie überstrahlen. Isfahan, die einzigartige Oasen-Stadt der Safawiden, die Stadt der Gärten, Moscheen und Paläste, ist nicht das Zentrum schiitischer Lehre. Es sind eher die Städte Qom und Maschhad, in denen die theologischen Institute und die al-hauza al-ilmiyya, die religiösen Wissenschaftszentren der Schia, heute angesiedelt sind. Beide Städte sind um den Schiiten besonders heilige Gräber entstanden; in Qom birgt ein kuppelbekrönter, von Minaretten und Prunkhöfen umgebener Schrein das Grab der Fatima al-Masuma, der Schwester des Imams Ali al-Rida; im Zentrum von Maschhad liegt das Grab dieses achten Imams der Schia selbst, Zentrum einer gewaltigen, immer wieder erneuerten und erweiterten Anlage, die pro Jahr etwa 20 Millionen Pilger empfängt. Ich habe in Qom und in Maschhad in Instituten gearbeitet, die an diese Schreine angeschlossen sind; die berühmte Feyyzieh-Universität, mit dem Schrein von Qom durch ein eigenes Portal verbunden (vor dem meine Portraits der Geistlichen entstanden sind), war der Ausgangspunkt der islamischen Revolution und gilt bis heute als der Hort traditioneller schiitischer Lehre und Ausbildung in Iran. Es ist sicher einer der abgeschlossensten Orte des Landes; dass ich dort immer wieder arbeiten konnte, hat manchen Experten verblüfft – seit Jahrzehnten sind dort keine Fotografien gemacht worden, kaum ein Nicht-Muslim wurde dort für mehr als einen kurzen Besuch empfangen.
In meiner Arbeit zum Schiismus habe ich eine Methode zur Erarbeitung einer künstlerisch-fotografischen Erfahrung angewandt, die ich „Community Involvement“ nenne und seit ihrer Entwicklung zu Beginn der 90er Jahre in verschiedenen Zusammenhängen erprobe und anwende. Mit dieser Methode wird die Fotografie zu einem Mittel, um komplexe geistige, soziale, politische Zusammenhänge zu erforschen und zu hinterfragen. Zunächst geht es darum, gemeinsam zu definieren, was die Kamera aufzunehmen vermag, und wie die Dinge, die dargestellt werden sollen, in richtiger Weise präsentiert werden sollten. Dies ist der erste Schritt zur Konzentration. Die fotografische Kamera nimmt nur das auf, was in ihren Bild-Rahmen passt – dies erfordert genaue Abwägung des Gegenstands und seines Umfelds; sie nimmt auch nur einzelne Bilder auf, die naturgemäß in einer Folge stehen – so werden Kontext, Serie, Abfolge diskutiert. Da es um sehr konkrete Fragen geht, wird die Arbeit ganz selbstverständlich zu einer Übung in Genauigkeit. Es wird auch schnell offenbar, dass die einfachsten Gegenstände unterschiedlich gesehen und beurteilt werden können – dies immer wieder deutlich zu machen, ist am Anfang meine vorrangigste Aufgabe. Da die Arbeit kontinuierlich immer wieder dieselben Personen einbezieht, entsteht ein dynamischer Prozess des Fragens und Antwortens, in dem die Rollen wechseln: keiner ist immer Lehrer, keiner immer der Lernende. In den theologischen Ausbildungsstätten der Schiiten haben die rationalen Wissenschaften seit jeher hohen Rang. Die Auffassung, dass intellektuelle Anstrengung jede Frage (letzten Endes selbst die tiefste Frage nach Gott und der göttlichen Weltordnung) zu lösen imstande ist, ist allgemein verbreitet: nie gab es in meiner Arbeit einen Moment, wo jemand zweifelte, dass wir am Ende unserer Anstrengung zu einem Ergebnis kommen würden, oder etwa nicht bereit gewesen wäre, sich auf die aus dem Arbeitsprinzip hervorgehenden Fragen, die notgedrungen ein Element der Pedanterie enthalten müssen, im Einzelnen mit Geduld einzulassen. Die Diskussion unterschiedlicher Sichtweisen ist eine grundsätzliche Übung in jeder Hauza; es war oft ein Vergnügen, zu sehen, wie sich die an Fragen der Theologie dialektisch geschulte Argumentation der Studenten plötzlich mit Fragen der Ästhetik, der Kunst und der Fotografie beschäftigte.
Auch einer zweiten Tradition der Hauza verdanke ich, dass meine Arbeit möglich wurde und erfolgreich zu einem Ende kommen konnte. Die Lehrer der schiitischen Schulen sind in der Wahl ihrer Stoffe und Lehrmethoden sehr frei; die Studenten – vor allem die älteren- wählen selbst ihre Lehrer, denen sie sich oft mit Hingabe anschließen. Sie sind daran gewöhnt, selbst Entscheidungen darüber zu treffen, womit sie sich beschäftigen, und bei welchem Lehrer es sich lohnt, auszuharren. Es geht natürlich um die Vermittlung von Wissen – den Studenten geht es aber auch um eine Lebenserfahrung, um das Sammeln von Begegnungen, in denen Elemente von Freundschaft, Bindung und gegenseitiger Verantwortung selbstverständlich sind und gesucht werden. Meine Methode baut auf solche Begegnungen auf; sie wird durch die Entwicklung, die die Beziehung zwischen mir und den am Projekt Beteiligten im Lauf der Zeit nimmt, befördert. Je mehr wir miteinander arbeiteten, desto besser funktionierte das Arbeitsprinzip. Das technische Gerät (die Kamera) arbeitet übrigens ähnlich – es kennt die Repetition, es ist verlässlich und genau in seinen Abläufen, birgt aber auch immer wieder Überraschungen, kennt den Reiz der Abweichung, zeigt, dass die Dinge niemals wirklich wiederholt werden können, ist im Gegenteil ständiger Lieferant von Belegen dafür, dass jede Situation ganz und gar einzigartig ist – und damit zerbrechlich, zart, von einem eigenen Zauber und einer eigenen Logik erfüllt.
Mein Blick richtete sich auf Lehrsituationen, auf die Orte des Lernens, auf die Diskussionen zwischen den Geistlichen, die ein wesentliches und besonderes Element ihrer Ausbildung ist. Von diesen Diskussions- und Argumentations-Übungen der Schiiten, die die rhetorischen und gedanklichen Fähigkeiten schulen, gibt es meines Wissens kaum aktuelle bildliche Darstellungen; im Rahmen meiner Arbeit sind in allen Städten Serien von Fotografien dieser schiitischen Diskussion entstanden, die einen eigenen fotografisch-künstlerischen Corpus darstellen. Die Ausstellung in Trier zeigt davon einige Beispiele. Wesentlich sind aber auch die im Lauf der Arbeit über Jahre entstandenen Portraits von Studenten und Lehrern der Hauzas von Qom, Maschhad und Isfahan. Es sind Portraits im Mittel-Format (die mit einer Hasselblad-Kamera gemacht wurden) sowie einige ausgewählte Beispiele von Schwarz-Weiß-Portraits, die in einem komplizierten Polaroid-Verfahren entstanden. Besondere Bedeutung haben die Ergebnisse meiner Arbeit mit jungen Frauen, die in verschiedenen theologischen Hochschulen für Frauen studieren, die nach der Revolution in Qom und Isfahan gegründet wurden.
Textauszug aus
Gott ist das Haus des Wissens. Fotografien eines Kunstprojekts von Hans Georg Berger. Herausgegeben von Jürgen Doetsch. Katholische Akademie Trier, 2005
© Hans Georg Berger (2005)

